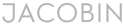In der ersten Woche des im Islam heiligen Ramadanmonats stehen die aus Palästina Geflüchteten auf den Philippinen weiterhin vor einer ungewissen Zukunft. Die vor dem Gaza-Krieg Geflüchteten sind über den gesamten Großraum Manila verstreut, werden von einer Gruppe zur nächsten gereicht und bemühen sich verzweifelt, eine gewisse Normalität und ein Friedensgefühl zurückzugewinnen. Obwohl Anfang 2025 ein Waffenstillstand vereinbart wurde, gibt es für die Menschen aus Gaza auf den Philippinen nur wenig Hoffnung. In Quezon City leben ein knappes Dutzend palästinensischer Familien in einer der größeren Siedlungen der Stadt, zusammengepfercht in einem Wohngebäude eines Filipinos, der Mitgefühl für ihre Notlage zeigt.
„Wir sind hier etwa zehn bis elf Familien. In Cavite gibt es noch mehr“, so der Universitätsprofessor aus Gaza Dr. Hamza (der darum bat, seinen richtigen Namen nicht zu nennen). „Unser Mietvertrag läuft nur bis März. Danach wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen.“
Bei Kriegsbeginn waren Hamza und seine Familie unter den Dutzenden von Familien gewesen, die vom Außenministerium (DFA) aus Gaza ausgeflogen wurden. Ursprünglich sollten nur ihre Ehefrauen evakuiert werden, die philippinische Staatsbürgerinnen sind. „Sie wollten nur die Frauen auf die Philippinen zurückführen“, sagt Hamza trocken, „aber sie (unsere Frauen) sagten, sie würden auf keinen Fall ins Flugzeug steigen, wenn sie uns nicht mitnähmen.“
Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits großflächige Bombardierungen im östlichen Gazastreifen begonnen, die Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser zum Ziel hatten. Hamza, der im Osten des Gazastreifens lebte, erinnert sich noch gut an die Nachrichten vom 7. Oktober, dem ersten Tag der Belagerung.
„Ich erinnere mich daran, wie die Bomben einschlugen. Es traf Wohngebäude nebenan. Als die Einschläge unserem Haus immer näher kamen, rief ich schließlich einen Freund im westlichen Teil der Stadt an, um herauszufinden, ob er uns bei sich aufnehmen könnte. Wir zogen noch am gleichen Nachmittag um. Andere hatten nicht so viel Glück wie wir“, erinnert er sich.
Kurz darauf wurde ganz Gaza dem Erdboden gleichgemacht. Beim Einkaufen wurde Hamzas Sohn Hassan von einer Bombe getroffen, die in der Nähe des Ladens einschlug. „Ich war außer mir. Ich habe versucht, ihn auf seinem Handy anzurufen, aber es ging niemand ran. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.“ Stunden später kam Hassan leicht verletzt nach Hause.
Als ihnen klar wurde, dass sie nirgends sicher waren, beschlossen sie, nach Westen in die Nähe der Küste zu ziehen. Dort traf er sich mit Abdullah, einem befreundeten Ingenieur, der ebenfalls mit einer .Filipina verheiratet ist.
Flucht aus Gaza
Jeder, der mit Israels regelmäßigen Bombenangriffen auf palästinensische Städte vertraut war, ging davon aus, dass dieser Krieg zumindest so ablaufen würde wie die Kriege der Vergangenheit. Aber der Konflikt, der im Oktober begonnen hatte, war anders – heftiger, willkürlicher.
"Wenn sie [die israelischen Streitkräfte] früher Bomben abwarfen, kündigten sie dies im Voraus an, damit die Menschen evakuiert werden konnten. Jetzt gibt es keine Warnung mehr", sagt Hamza. Als der Konflikt im Oktober 2023 begann, ahnten die Menschen in Gaza kaum, dass er sich zu einer der schlimmsten humanitären Krisen in Palästina entwickeln würde, einem Land, das die Narben von einem Jahrhundert Völkermord und Kolonialherrschaft trägt.
„Eine Bombe schlug direkt in unser Haus ein“, sagt Abdullah, Hamzas Freund aus dem Westen von Gaza. „Meine Familie war da gerade im Gebäude.“ Die Bombe kostete 25 Angehörigen von Abdullahs Familie das Leben. Wie Hamza beschloss er damals, dass es an der Zeit war, zu gehen.
Hamza und Abdullah haben beide eine enge Verbindung zu den Philippinen, da sie früher schon einmal dort gelebt haben. Abdullah hat ein Ingenieursdiplom vom Emilio Aguinaldo College und Hamza machte seinen Abschluss an der Universität von Santo Tomas. Beide lachen, als sie sich an ihre Zeit in Manila erinnern und einen kurzen Moment der Leichtigkeit genießen. Als das Außenministerium schließlich zustimmte, die Palästinenser*innen auf die Philippinen auszufliegen, machten sich die Familien von Hamza und Abdullah auf die lange und beschwerliche Reise zu einem ägyptischen Auffanglager jenseits der Grenze, wo sie auf ihre Abfertigung warten mussten. Dort, so sagen sie, sei ihnen wirklich klar geworden, was sie alles zurückließen. Arbeit, Familie, Geschäfte, ihr Leben.
Leben in Manila
Bei ihrer Ankunft auf den Philippinen wurden die Familien in einem Hotel in Pasay untergebracht, wo sie warten mussten, bis eine Unterkunft für sie gefunden war. Verschiedenen NGOs und Volksorganisationen gelang es, für die Palästinenser*innen eine Unterkunft in Marikina zu verschaffen. Nach einem Monat wurden sie jedoch aufgefordert, die Gegend zu verlassen, weil gemunkelt wurde, dass vermeintliche Kommunisten ihnen helfen würden.
„Die Leute behaupteten, es sei gefährlich, in Marikina zu bleiben. Sie sagten, wir stünden unter Polizeibeobachtung. Und dass die Leute, die uns halfen, Linke oder Sympathisanten der Rebellen seien“, so Hamza. Sie landeten schließlich in Quezon City, wo Studierende der Universität der Philippinen, verschiedene Wohltätigkeitsgruppen und Privatpersonen halfen, Spendenaktionen zur Unterstützung palästinensischer Familien zu organisieren. Ohne Zufluchtsort und ohne Besitztümer gerieten die vor dem schrecklichen Gazakonflikt Geflohenen nun in einen anderen, aber ebenso heimtückischen Krieg in Manila. Sie wurden in die lokale Politik verstrickt und sind hin- und hergerissen zwischen verschiedenen politischen und ideologischen Gruppierungen. Der Polizeigeheimdienst, so die Palästinenser*innen, beobachte sie genau und wisse, mit wem sie sich unterhalten und wer mit ihnen spricht. Es fällt ihnen jetzt auch schwer, denen zu vertrauen, die ihnen Hilfe anbieten. Denn sie befürchten, dass sie das letzte bisschen Sympathie der Regierung verlieren oder als politischer Spielball ausgenutzt werden könnten.
„Wir wollen nicht in weitere Konflikte verwickelt werden, wir wollen nur Frieden“, sagt er voller Verzweiflung und Angst.
Fatima und Mariam, beide Filipinas mit palästinensischen Ehemännern, haben beide ein Leben in Gaza zurückgelassen. „Wir haben uns in Gaza nie wirklich als Außenseiterinnen gefühlt. Wir wurden von Anfang an freundlich aufgenommen.“ Fatima und Mariam waren zusammen mit Dutzenden anderer Filipinas und Filipinos maßgeblich daran beteiligt, das Außenministerium davon zu überzeugen, den Palästinenser*innen die Ausreise in die Philippinen zu erlauben. „Gaza war ein friedlicher Ort, anders als es in den Medien dargestellt wird. Bei uns gibt es keine sektiererische Gewalt. Wir beurteilen Menschen nicht nach ihrer Religion. Christ*innen lebten mit Muslim*innen zusammen und umgekehrt. Wir waren alle Brüder und Schwestern.“
„Einige der ältesten Kirchen des Christentums befinden sich in Gaza. Jetzt sind all diese Kirchen durch israelische Luftangriffe zerstört worden", stimmt Hamza zu.
Ungewisse Zukunft
Ende Januar 2025 wurde zwischen der Hamas und den israelischen Streitkräften ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen, das es den vertriebenen Palästinenser*innen ermöglichte, nach einer 15-monatigen Belagerung endlich nach Hause zurückzukehren. Das Abkommen weckte auch bei den Geflüchteten auf den Philippinen die zaghafte Hoffnung auf eine Chance, zu ihren Angehörigen zurückzukehren, die sie zurückgelassen hatten.
"Natürlich wollen wir zurück und uns am Wiederaufbau beteiligen, aber jetzt gibt es auch noch Trump und diesen ganze Plan, Gaza in einen Urlaubsort zu verwandeln", sagt Hamza. Nachdem Donald Trump 2024 die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, legte er seine Pläne zur Stärkung der US-israelischen Partnerschaft offen. Trump äußerte sogar den Wunsch, Land im Gazastreifen zu kaufen und es in Urlaubsressorts zu verwandeln. Nach den US-Wahlen und der übertriebenen Unterstützung politischer Anliegen Israels durch eine rechtsextreme Regierung in Washington zeigen sich die Palästinenser*innen auch besorgt über ihren Aufenthaltsstatus auf den Philippinen – denn diese sind enge Verbündete der USA und Israels. Momentan haben sie keinen offiziellen Aufenthaltsstatus, obwohl sie sich an Regierungsvertreter*innen und das Justizministerium gewandt haben. „Sie haben immer noch nicht geantwortet. Wir haben sogar schon Senator*innen um Hilfe gebeten, aber bekommen keine Antwort."
Im Wohngebäude, wo Hamza, Abdullah, Fatima und Mariam untergebracht sind, versuchen die Familien, eine gewisse Normalität wiederherzustellen. In ihren Wohnungen herrscht das rege Treiben des Alltagslebens. Kinder in Schuluniform kommen und gehen, während die Eltern sie empfangen oder ihnen häusliche Pflichten auferlegen. Draußen vor dem Tor dröhnt ein Tuk-Tuk mit Lieferungen für einen Imbissstand mit Nahostspezialitäten, der von einem der Palästinenser betrieben wird.
Im März endet der Mietvertrag für ihre Wohnung. Auch die Gelder aus Spenden und Wohltätigkeitsaktionen sind versiegt, sodass die Palästinenser*innen nicht wissen, was ihnen bevorsteht. Während ihre Brüder und Schwestern in Palästina mit dem Wiederaufbau beginnen, wappnen sich die Palästinenser*innen auf den Philippinen für eine ungewisse Zukunft. Und auf der anderen Seite des Ozeans, über 9.000 Kilometer entfernt, brechen die Menschen in Gaza, von Schutt und Asche umgeben, jeden Abend ihr Ramadan-Fasten. Die Menschen aus Gaza in Manila brechen ebenfalls ihr Fasten, mit palästinensischen Speisen und philippinischen Snacks. Beide Gruppen kämpfen mit einem Trauma, das sich über Generationen erstreckt. Beide versuchen, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht zu verlieren.
Alle Namen wurden geändert, um die Identität der im Artikel erwähnten Personen geheim zu halten. Bestimmte Details wurden aus Gründen der Anonymität ebenfalls abgeändert. Alle Geschichten sind so wiedergegeben, wie sie von den Palästinenserinnen berichtet wurden.*
Foto: Jonah Kayguan/Bulatlat